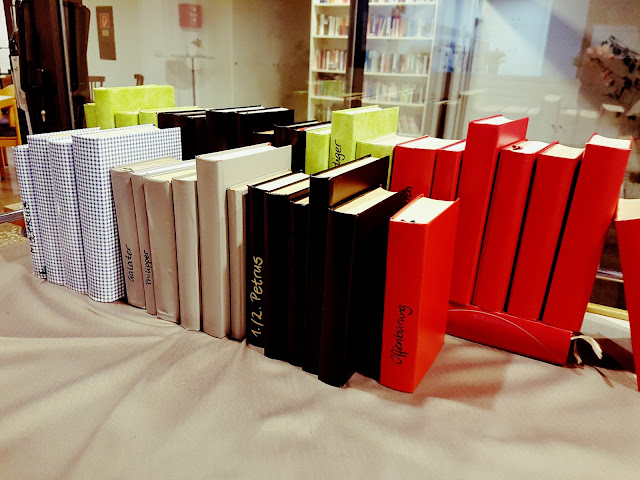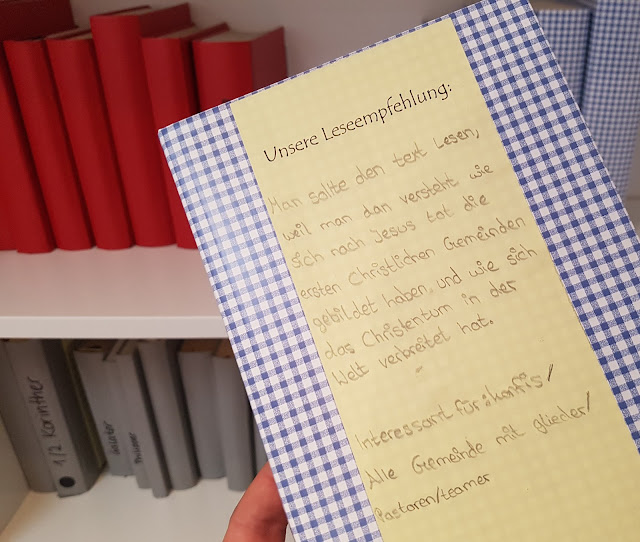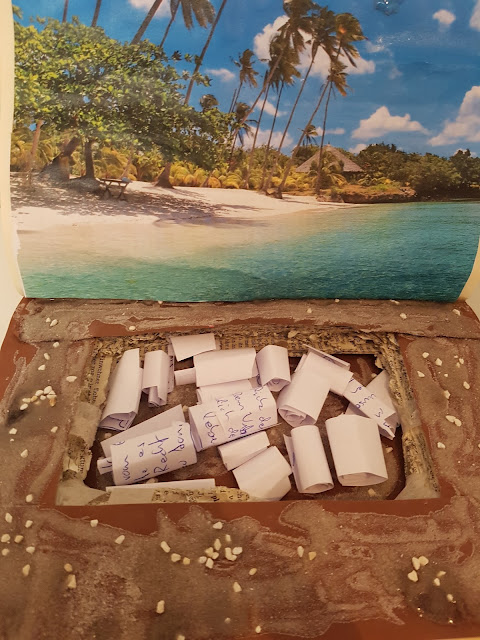Wenn Jungs anders sind.
Das ist so ein Thema, mit dem manche Eltern sich an ihren Pfarrer wenden.
Oder an den Hausarzt.
Eltern, die sich Sorgen machen um ihr Kind, Angst haben vor dieser Welt und den Wunden, die sie für die bereithält, die anders sind.
Eltern, die wütend sind, weil ihr Junge andere Wege geht, Wege, die sie nicht verstehen, nicht kennen, nicht gut finden.
Das ist so ein Thema, mit dem manche Eltern sich an ihren Pfarrer wenden.
Oder an den Hausarzt.
Eltern, die sich Sorgen machen um ihr Kind, Angst haben vor dieser Welt und den Wunden, die sie für die bereithält, die anders sind.
Eltern, die wütend sind, weil ihr Junge andere Wege geht, Wege, die sie nicht verstehen, nicht kennen, nicht gut finden.
Durham, englischer Nordosten, 1984. Weit weg von Kathedrale und Universität liegen die engen Bergarbeitersiedlungen, winzige Einfamilienhäuser, 70 m² auf drei Etagen, eng an eng gepresst, roter Backstein, dazwischen Beton, Klo in einem kleinen Verschlag auf dem Hinterhof. Das Straßenbild ist wie das Klima ist wie der Dialekt, rau und unverputzt. Ein spindeldürrer Junge, neun, vielleicht zehn, turnt durch eine winzige, bis unters Dach verdreckte Küche. Man sieht, dass hier nur Männer wohnen, oder fast. In einer Ecke stehen selbstgemalte Streikschilder: Thatcher Raus, Nicht aufgeben! Der Junge, Billy Elliot, hievt einen Topf mit Eiern vom Gasherd, fängt verkohlte Toastbrotscheiben aus der Luft, balanciert alles auf einem Tablett, schiebt mit dem Kopf die Tür zu einer winzigen Kammer auf, entdeckt das leere, zerwühlte Bett, flucht laut auf, lässt das Tablett fallen. Krachend fällt die Tür ins Schloss. Er rennt durch die engen Straßen, im Zickzack zwischen Gartenzäunen und Briefkästen, unter Wäscheleinen her, um eine Ecke und hinaus auf eine überwucherte Wiese am Fluss. Dort steht eine ältere Dame im Nachthemd, sieht sich verwirrt um. Komm, Oma, sagt Billy Elliot, nimmt sie behutsam in den Arm und führt sie nach Hause. „Ich wollte Ballettänzerin werden“, erklärt sie aufgekratzt. „Jaja, Oma, wir gehen nach Hause“, sagt er. Im Hintergrund kommen auf einer Brücke mit quietschenden Reifen mehrere Mannschaftswagen zum Stehen, Polizisten in Krawalluniform und mit Schutzschilden steigen aus und marschieren zum Bergwerk, wo seit einem Jahr die Bergarbeiter streiken. Wut liegt in der Luft, in erster Reihe stehen Billy Elliots Vater und sein älterer Bruder.
Die Mutter ist gestorben und nicht mehr da. Die Großmutter dement und auch nicht mehr wirklich da. Die Frauen fehlen. Ähnlich wie bei Josef und seinen Brüdern, im Hause Jakobs. Es gibt natürlich Frauen, sogar mehrere, und das ist Teil des Problems, aber sie bleiben merkwürdig unsichtbar in der ganzen Geschichte. Und auch Josefs Mutter ist gestorben. Wut liegt in der Luft, es zündelt und knistert zwischen den Brüdern. Sowieso, weil es Haupt- und Nebenfrauen gibt, und damit auch Söhne, die dem alten Vater Jakob mehr am Herzen liegen als andere. Martin Luther sagt dazu, man solle nicht meinen, dass die alten Heiligen aus Holz oder Stein, also gefühl- und affektlos gewesen seien. Die Familie von Jakob, Lea, Rahel, Bilha und ihren Kindern Dina und den Brüdern, ist zerstritten, und wie in vielen dysfunktionalen Familien ist auch hier nicht klar, wer hier Opfer, Täter, wer Schuld und wer verletzt ist. Wahrscheinlich alle.
Josef ist in der Brüderhierarchie als einer der jüngsten ganz weit unten, aber trotzdem Vaters Liebling. Und eine Petze, er erzählt seinem Vater brühwarm, was seine anderen Söhne über ihn reden. Jakob aber hatte Josef lieber als seine anderen Söhne, und er schenkte Josef einen bunten Rock.
Um Billy Elliots Hals baumeln braune, zerschlissene Handschuhe. Er hat sie in von seinem Vater geschenkt bekommen, und der wiederum von seinem Vater. „Trage sie mit Stolz, Sohnemann“, hat der Vater gesagt. Man redet nicht viel in der Familie Elliot, Konflikte werden bearbeitet, in dem man Türen knallt oder die Faust sprechen lässt. Missmutig trottet Billy Elliot zur Sporthalle, lässt sich in der ersten Runde niederschlagen. Trag die Handschuhe mit Stolz, brüllt der Vater, der das Training beobachtet hat, bevor er wütend rausstürmt und die Tür hinter sich zuknallt. Nach dem Boxtraining wird ein Klavier in die Halle gerollt, die kettenrauchende Miss Wilkinson hält ihre Ballettstunde. Fasziniert schaut Billy, zuerst wegen der kleinen Nachbarstochter, aber dann ist er mehr und mehr gebannt von den fließenden Bewegungen der Ballettschülerinnen. „In die Reihe mit dir“, schnauzt die Ballettlehrerin und zieht ihn an die Stange. Erst stakst Billy etwas ungelenk umher, dann beginnt er, sich in den Bewegungen zuhause zu fühlen, zieht seine Boxstiefel aus und die Ballettschuhe an, hängt die Boxhandschuhe an den Nagel und spürt zum ersten Mal: Wenn ich tanze, dann ist es so, als ob ich mich in mir selbst verliere, wie Elektrizität. Auf dem Nachhauseweg springt, tanzt, schwebt Billy Elliot über Beton und durch den Hof mit dem Klo im Bretterverschlag. Demi plié, glissade, arabesque. Und Billy Elliot verliert sich in sich selbst und träumt vom Tanzen.
Josef träumt auch, von Brüdern, die sich vor ihm verneigen, und ist so undiplomatisch, das auch noch zu erzählen. Und dann ist da dieses Kleidungsstück, das er von seinem Vater bekommen hat. Wir wissen nicht genau, was das für ein Rock war. Ein bunter Rock vielleicht, oder einer mit langen Ärmeln, auf jeden Fall ein wertvolles Kleidungsstück, das nicht für die Feldarbeit geeignet ist. Was wenige Ausleger sehen: Das Wort, das hier benutzt wird, kommt auch an einer anderen Stelle vor, und da meint es ein Prinzessinnenkleid.
Josef ist anders. Anders als seine Brüder, als Ruben, der Erste und Stärkste, der wie Wasser aufwallt, und anders als die anderen: Simon und Levi tragen mörderische Waffen, sind voll Zorn und Grimm, Juda ist ein Löwe, Dan eine Schlange, Benjamin ein reißender Wolf. Und Josef träumt und trägt ein Prinzessinnenkleid. Jetzt kommt, sagen seine Brüder, wir wollen ihn töten und ihn in eine der Zisternen werfen, und wir werden sagen: Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Wir werden ja sehen, was aus seinen Träumen wird…
In der Küche der Familie Elliot, zwischen Stapeln von Geschirr und Streikschildern. Der Widerstand der Gewerkschaft bröckelt. Alles schreit, nur die Oma sitzt wie versteinert. Die Ballettlehrerin macht einen Hausbesuch und erzählt von ihren Plänen, Billy bei der Königlichen Ballettakademie anzumelden. Alle schreien, am lautesten sein älterer Bruder. Verdammt nochmal, brüllt er und seine Stimme überschlägt sich, dann tanz, tanz, verdammt nochmal, und er packt seinen kleinen Bruder und rammt ihn auf den Küchentisch. Komm, tanz für uns, höhnt er. Billy Elliot steht wie festgefroren da, und alle schreien. Bis die Ballettlehrerin aus der Küche stürmt, die Tür knallt. In der nächsten Szene sieht man Billy Elliot durch die engen Straßen tanzen. Demi plié, glissade, arabesque.
Jungs, die anders sind, haben es nicht leicht. Die nicht, die weiblicher scheinen als andere, aber auch die nicht, die lauter, lebhafter und draufgängerischer sind als die, die man normal nennt. Den Einen sagt man: „Jungs spielen nicht mit Puppen.“ „Ein Indianer kennt keinen Schmerz“, und man winkt ihnen auf dem Schulhof mit abgeknicktem Handgelenk zu. Die einen nennt man „Schwuchtel“, die anderen nennt man „schwierig“ oder „ADHSler“, gibt ihnen Ritalin und allgemein schlechte Chancen in einem Bildungssystem, das Stillsitzen und Bravsein mit besseren Noten und Schulempfehlungen belohnt als Raufen, Schreien und Fußballspielen.
Die großen Männergestalten in der Bibel sind auch oft anders, anders als die Gesellschaft sie gern hätte. Da sind die Depressiven – Saul, Elias, Paulus. Da sind die Alten und Schwachen – Abraham, Simeon. Da sind die viel zu Schönen – wieder Saul – und die viel zu Hässlichen, so wie Paulus. Da sind Männer, die Männer lieben – David und Jonathan und ein geheimnisvoller Lieblingsjünger im Johannesevangelium. Und da sind die, die sogar von ihrer eigenen Familie für verrückt gehalten werden – wieder David, und Jesus selbst: Und Jesu Familie machte sich auf, um ihn zu holen, denn sie sagten: Er ist verrückt (Mk 3,21). Der Jesus, der im Lukasevangelium mal als Hirte, der seinen Schafen hinterhereilt, mal als Hausfrau, die ihren Silbergroschen sucht, beschrieben wird, und von dem Paulus später schreibt: In Christus ist weder Mann, noch Frau (Gal 3).
Wer anders ist, hat in der Bibel gute Chancen. Entweder, weil Gott ein besonders großes Herz für die Unikate unter seinen Schöpfungen hat, oder weil das enge Verhältnis zum Ewigen, das Berührtsein von der anderen Seite Menschen verändert, spürbar anders werden lässt, sodass sie es schwer haben, ihren Platz in der Gesellschaft zu halten. Wer anders ist, hat gute Chancen – aber hat es nicht leicht in der Welt, die ganz eigene Wunden für die bereithält, die anders sind, Wunden, die in religiösen Kreisen oft tiefer geschlagen werden und schwerer verheilen als anderswo… Fürwahr,er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre.Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet undum unsrer Sünde willen zerschlagen.Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.
Was heißt das für uns als Gemeinde? Wie viel Platz räumen wir denjenigen ein, die „anders“ sind, die an der Norm scheitern oder sich selbstbewusst darüber hinwegsetzen? Wie sehr gestehen wir uns selbst unser Anderssein ein, unsere Abweichungen, unsere Spleens, unsere Träume vom Tanzen?
Josef gelangt auf Umwegen nach Ägypten. Dort macht er Karriere, aber der Weg nach oben ist mit Rückschlägen, Verrat, Sex- und Machtmissbrauch und Intrigen gepflastert. Unter seiner Verwaltung wird Ägypten reich, seine Träume erweisen sich als zuverlässige Wirtschaftsprognosen und ermöglichen es, rechtzeitig Vorräte anzusammeln. Eine Hungersnot zieht über die Welt, und vierzehn Jahre nach dem Mordversuch an Josef werden seine Brüder zu Flüchtlingen und ziehen nach Ägypten und begegnen ihm dort wieder, sind verunsichert, ängstlich und haben Angst vor seiner Rache, als sie ihn erkennen. Und Josef weint und sagt: „Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen.“
Billy Elliot wird in London an der Ballettakademie angenommen. Vierzehn Jahre später betreten sein Vater und sein Bruder einen großen Konzertsaal, sichtlich verunsichert in der fremden Umgebung, falsch angezogen, ungewohnt. Hinter den Kulissen bereiten sich die Tänzer für den Auftritt vor. Billy Elliot ist erwachsen, athletisch, trägt weißgefiederte Hosen, ist am ganzen Körper weiß geschminkt mit einem schwarzen Streifen auf Scheitel, Stirn und Nase. Das Orchester spielt, die Töne schwellen an zu Tschaikowskis Schwanensee. Für einen Moment stockt die Musik, der Vater im Publikum hält den Atem an, zuckt zusammen: Das Orchester spielt bombastische Klänge, Streicher und Bläser in H-Moll, und Billy Elliot betritt die Bühne und tanzt, springt, schwebt, fliegt, als hätte die Schwerkraft ihn freigegeben. Und sein Vater bricht in Tränen aus.
Und Jakob lag auf dem Sterbebett und segnete seine Söhne und sprach: Josef wird wachsen, er wird wachsen wie ein Baum an der Quelle, dass die Zweige emporsteigen über die Mauer. Von deines Vaters Gott werde dir geholfen, und von dem Allmächtigen seist du gesegnet mit Segen oben vom Himmel herab, mit Segen von der Flut, die drunten liegt, mit Segen der Brüste und des Mutterleibes. Mögen die Segnungen der ewigen Berge, die köstlichen Güter der ewigen Hügel auf das Haupt Josefs und den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern kommen.
Wenn Jungs anders sind.
Das ist so ein Thema, mit dem manche Eltern sich an ihren Pfarrer wenden.
Vor einigen Tagen gingen die Worte einer Mutter über das Internet durch die Welt.Sie schrieb:
Das ist so ein Thema, mit dem manche Eltern sich an ihren Pfarrer wenden.
Vor einigen Tagen gingen die Worte einer Mutter über das Internet durch die Welt.Sie schrieb:
„Mein sechsjähriger Sohn trägt gern Nagellack. Er zieht gern Mädchenkleidung an und Tutus. Vielleicht ist das eine Phase, vielleicht auch nicht. Ich liebe ihn und akzeptiere ihn, wie er ist. Ich habe immer gedacht, dass ihn das schützt vor den Schmerzen böser Worte und vor Schulschlägern, und ich habe mir nie Sorgen gemacht.
Vor ein paar Tagen kam er nach Hause und erzählte von Kindern in der Schule, die ihn ärgern wegen seines Nagellacks, und zum ersten Mal in seinem Leben war ich nahe dran, ihn zu überreden, es sein zu lassen, diesen Teil von sich zu verstecken. Weil ich zum ersten Mal Angst hatte, er würde eines Abends niedergeschossen, wenn er mit Freunden unterwegs ist. Ich hatte solche Angst, dass ich dachte, es wäre besser, wenn ich aufhören würde, ihn in seinem Anderssein zu bestärken. Und dann dachte ich an all die Gründe, warum ich ihn so sein lasse, wie er ist. […]
Ich will, dass diese Welt sich ändert. Dass sie besser wird für ihn, ihn verdient. Weil er ein wunderbarer, großartiger Mensch ist. […] Er hat ein Leuchten in sich, das niemand auslöschen kann, so sehr das auch schon manche Menschen versucht haben. […] Gestern haben wir neuen Nagellack gekauft und Tutus getragen. Hier ist er, Welt. Sieh meinen Sohn als den wunderbaren Menschen, der er ist. Zeig ihm Liebe. Zeig ihm Respekt. Helft uns, die Welt so zu machen, dass sie ihn verdient.“
Wenn Jungs anders sind.
Das ist so ein Thema, mit dem manche Eltern sich an ihren Pfarrer wenden.
Eltern, die sich Sorgen machen um ihr Kind, Angst haben vor dieser Welt und den Wunden, die sie für die bereithält, die anders sind.
Eltern, die wütend sind, weil ihr Junge andere Wege geht, Wege, die sie nicht verstehen.
Das ist so ein Thema, mit dem manche Eltern sich an ihren Pfarrer wenden.
Eltern, die sich Sorgen machen um ihr Kind, Angst haben vor dieser Welt und den Wunden, die sie für die bereithält, die anders sind.
Eltern, die wütend sind, weil ihr Junge andere Wege geht, Wege, die sie nicht verstehen.
Und ich sage: Segnet Eure Kinder. Sagt ihnen:
Geh, geh hinaus in die Welt, dorthin, wo Er dich führt. Und ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und du sollst ein Segen sein.
Geh, geh hinaus in die Welt, dorthin, wo Er dich führt. Und ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und du sollst ein Segen sein.
Amen.
_______________________________________________
Die Grundidee für die Predigt verdanke ich Kerstin Söderblom und ihrem Artikel auf evangelisch.de - danke dafür!